en | de
Much of this blog revolves, directly or indirectly, around the question of why we behave the way we do. We discuss thoughts, the role of chance, our place in the universe, and even psychological disorders. We believe that many existential questions can be answered or resolved by adopting the most truthful orientation possible in our thinking about ourselves. By this, we mean that we attempt to construct our web of beliefs with as few, and as mutually independent, objective insights as possible. Just as a good joke should have “zero fat” on its bones, so too should our self-concept be lean and unencumbered. Only in this way can we develop an understanding that is not only robust, but also sufficiently manageable, and therefore subject to change and adaptation. Fundamentally, we all do exactly this without interruption, albeit to varying degrees of awareness. Like every living being, adaptation to our environment is, so to speak, what we strive for by definition. And that is precisely what we do, day in and day out.
Whereas most mammals automatically seek the best fit with their surroundings through the search for food, shelter, and mates, in many societies we have reduced our entire environment to a purely social one. Here, adaptation does not mean finding nourishment, but rather finding a niche within several differently sized groups of people. Within a vast but anonymous state, we develop our personalities and abilities to fit society’s needs, shaped by the education system, the media, and daily social interactions in which we calibrate these influences with others. We do not develop these traits for coexistence with animals, plants, or our actual physical environment, but exclusively for integration into the human society in which we happen to grow up. We pursue knowledge and behavioral patterns that enable us to find a place within an abstract social network, which, according to an unspoken promise, will provide us with food, shelter, and partners in exchange for our contribution. Rarely are we consciously aware of this, yet it remains true nonetheless – we live for others.
Even though neither we nor our families, for example, may have access to real influence—indeed, we may never have seen or shaken hands with our chancellor or president—we nonetheless devote the first decades of our lives to this promise of the state, which hovers above and between us. Not only is this promise not an actual one, since it has never been explicitly stated, but it can also leave us deeply disappointed if we do not see it fulfilled in its entirety. Ultimately, we all simply work for vouchers, which we can redeem with others for their goods and services, deploying those skills for which others are willing to give us such vouchers. Seldom do we create anything new ourselves; instead, we are supplied with a continuous stream of goods by other people. The abstract social network has become our world.
Even within the smaller groups that surround us in our daily lives, we assimilate ourselves. We identify the inherent hierarchies that exist and do everything in our power to secure an appropriate position within them. Although, in modern times, these group dynamics are no longer decisive for the acquisition of food, protection, or the selection of a mate, we nevertheless navigate these smaller social circles as if they were the same life-critical, tribe-like communities in which humans lived for millennia. We experience unhappiness when we feel isolated and radiate with joy when we are recognized or admired. There is no magic or mystical force at play here, but rather a straightforward survival instinct that has likely changed little since the Stone Age. Evidently, the survival of our ancestors was acutely threatened if they were excluded from their tribal communities. Imagine, for instance, being shunned to the extent that you are denied access to any community, any marketplace, or any other person. You are turned away from the hospital, ejected from the grocery store. How would you survive? No clothing, no utensils, no shelter (try building a house without tools or materials), no food unless you find it yourself. While we may occasionally romanticize the idea of a life as a recluse, the reality is that surviving entirely without support—especially, for example, during a northern European winter—would only be possible for a few hours. Thus, it is not surprising that our highest priority has become: adapt to those around you, become like them; whatever happens, you must not remain alone. Become like them, at any cost. Even though, in many countries, loneliness has lost its immediate threat to existence, our primal fear of losing group affiliation persists.
As is often the case, such emotions are most clearly observable in children, who still wear their feelings unfiltered on the surface. Recall a time when you were a child yourself. You are in third grade and having a truly bad day. You encounter older students who not only tease you but also humiliate and hurt you. Even your homeroom teacher is in a bad mood and singles you out in front of the entire class because you forgot your homework. When you return home after school, no one is there. Normally, your mother would be home at this time to help with your homework, but today the house is empty, the windows are closed, all the lights off. You find a note: “We are gone and will not return.” The next day, still no one comes, and you realize the note was meant in earnest. Which part of this narrative is the most frightening, the most depressing? The worst thing that can be done to children is neither harsh words nor physical punishment. Being left alone by one’s parents is the greatest fear young children possess. It is, therefore, unsurprising that adults, too, orient their entire lives around the groups to which they believe they must belong. However, the necessity of belonging is, in this context, more of a fear-driven illusion. What happens if our neighbor no longer “likes” us? Why do we feel compelled to smile at a colleague and talk about our last vacation? How bad, in actuality, is it if someone holds a different political conviction or opinion? If we could adapt our Stone Age brains to present-day realities, the answer to all these questions would be: nothing truly threatening occurs. No one is obligated to speak with us, and we do not need to maintain good relations with a colleague to ensure help during the next crop failure or to defend against a neighboring tribe. The opinions we encounter are inconsequential to our survival; we need not strive to belong to the strongest or largest group to survive the next tribal conflict. We do not have to please anyone or swear allegiance to any group to endure the coming winter. Thanks to our voucher-based economic system, we will continue to have access to food, shelter, and partners.
We—the authors of this blog—believe it is wise not to take the rules of the small and large groups that surround us too seriously. Indeed, our capacity for cooperation on large scales defines us and enables a life of safety, health, and prosperity. Yes, our psyche is as it is, and our social emotions, which guide our behavior in small groups, remain with us for better or worse. There is no reason to disparage or wish to discard these phenomena. Not least, the most beautiful and fulfilling emotions we know are part of this package. However, these same emotions can also keep us trapped, under the guise of existential anxiety, in harmful and, above all, arbitrary patterns of thought and social structures. Recognizing these patterns for what they are and categorizing them accordingly makes them more flexible and prevents us from rigidly adhering to them, even when they lead us directly into ruin. More directly, as individuals, we can take a step back and in so doing strip these patterns of their terror. This, ultimately, is what we seek to achieve in this blog—with calm and discernment.
When examining other cultures, one can readily discern detrimental patterns of thought. As Hanno Sauer illustrates in Moral, there have been—and continue to be—remarkable initiation rites for young men and women across the world. Within the Etoro tribe of New Guinea, it is customary for young men to ingest the semen of hierarchically senior males orally in order to be recognized as men. While it is likely that nearly all of the seven billion people on this planet—including the neighboring Kaluli tribe—would respond to this practice with astonishment or disgust, it may be assumed that the Etoro themselves regard the rite as entirely normal. The aforementioned Kaluli, by contrast, require the ingestion of semen anally, a practice that in turn elicits incomprehension among the Etoro.
Likewise, punishments for social misconduct are marked by absurdly exaggerated details. Instead of looking to another place, the same effect of astonished revulsion can be achieved through a temporal shift. It is widely known that the universally practiced death penalty in Europe offered, well into the nineteenth century, a vast array of cruelties. Far less well known, however, is the fact that executions were regarded not only as popular spectacles but also as sources of fortune and healing. It is recorded that people pressed around the freshly executed in order to seize their blood or parts of their bodies. Thus, the apothecary Johann Schröder, writing in the mid‑seventeenth century, described the preparation of medicines from the remains of executed persons, while contemporaries were said to have placed fingers or penises into their beer barrels to improve sales. The trade in such “charms” was widespread and generally accepted as normal. Not least, the severed limbs of newborns were coveted accessories throughout Europe, believed to render their bearer invisible, as attested, for example, in the sixteenth‑century diary of the Nuremberg executioner Meister Frantz.
These cruel and repulsive accounts of socially established behaviors could be discussed at length across several volumes. Our brief remarks above merely serve to illustrate: none of this is in the least surprising, but rather precisely what one should expect in a relentlessly social structure. No ritual, no rule is absurd if it is collectively practiced. No matter, who is reading this text: you’re body and brain are indiscernable from those of the Etoro, who make young men perform oral sex on their elders or the Europeans, who were gathering around freshly beheaded criminals, to drink their splashing blood. Therefore, direct your attention to the present and to the small and large groups that surround you, and rigorously examine which rules you are following or what you expect from others. More importantly, when you experience social pressure to conform and subordinate yourself to the interests of a group, remind yourself that the fear arising within you is an illusion. At such moments, take advantage of the benefits offered by our modern world to do good for yourself and others—take a step back, recognize the social game being played around you, and make your next decision with composure. You are freer and more secure than you may believe.
en | de
Vieles in diesem Blog dreht sich direkt oder indirekt um die Frage, warum wir uns so verhalten, wie wir es tun. Wir sprechen über Gedanken, die Rolle des Zufalls, unseren Platz im Universum und sogar psychische Erkrankungen. Wir glauben, dass sich viele existentielle Fragen dadurch beantworten oder auflösen lassen, dass wir eine möglichst wahrhaftige Ausrichtung unserer Gedanken über uns selbst einnehmen. Damit ist gemeint, dass wir versuchen unser Netz an Überzeugungen mit möglichst wenigen, voneinander möglichst unabhängigen objektiven Erkenntnissen aufzuspannen. Wie ein guter Witz sollte auch unser Bild von unser selbst „zero fat“ auf den Knochen haben. Nur so können wir ein Verständnis entwickeln, dass nicht nur belastbar, sondern auch halbwegs überschaubar und damit veränderlich und anpassbar bleibt. Im Grund tun wir alle genau das ohne Unterbrechung, wenn auch in unterschiedlichen Graden des Bewusstseins. Wie jedes Lebewesen ist eine Anpassung an unsere Umwelt das, was wir sozusagen per Definition anstreben. Und genau das tun wir, tagtäglich. Während die meisten Säugetiere durch die Suche nach Nahrung, Schutz und Partnern automatisch den besten Fit mit ihrer Umgebung anpeilen, haben wir in vielen Gesellschaften unsere komplette Umgebung auf eine rein soziale reduziert. Anpassung heißt hier nicht Nahrung finden, sondern eine Nische in mehreren, unterschiedlich großen Gruppen von Menschen einzunehmen. Innerhalb eines riesigen, aber anonymen Staates entwickeln wir durch das Bildungssystem, die Medien und die tägliche soziale Interaktion, in der wir diese Einflüsse mit anderen abgleichen, unsere Persönlichkeiten und Fähigkeiten passend, um der Gesellschaft von Nutzen zu sein. Wir entwickeln diese nicht für ein Zusammenleben mit Tieren, Pflanzen oder der tatsächlichen, physischen Umgebung, in der wir uns befinden, sondern ausschließlich zur Einpassung in die menschliche Gesellschaft, in der wir zufälligerweise aufwachsen. Wir streben Wissen und Verhaltensformen an, die es uns ermöglichen einen Platz in einem abstrakten sozialen Netz zu finden, das uns einem unausgesprochenen Versprechen nach für unseren Beitrag mit Nahrung, Schutz und Partnern versorgt. Es ist uns selten in dieser Form bewusst, aber nichtsdestotrotz wahr. Obwohl wir selbst oder unsere Familie beispielsweise keinen Zugang zu wirklichem Einfluss, ja noch nicht einmal unseren Bundeskanzler oder unsere Präsidentin jemals gesehen oder die Hand gegeben haben, investieren wir die ersten Jahrzehnte unseres Lebens in dieses über uns und zwischen uns wabernde Versprechen des Staates, in dem wir leben. Nicht nur, dass dieses Versprechen keines ist, da es nie direkt ausgesprochen wurde, es kann uns dennoch schwer enttäuscht zurücklassen, sollten wir es nicht umfänglich erfüllt bekommen. Letztendlich arbeiten wir alle schlicht für Gutscheine, die wir bei anderen Menschen für ihre Waren und Dienstleistungen einlösen können, und setzen dafür die Fähigkeiten ein, für die andere bereit sind, uns solche Gutscheine zu geben. Selten schaffen wir selbst Neues, sondern werden mit einem kontinuierlichen Strom von Dingen durch andere Menschen versorgt. Das abstrakte, soziale Netz ist zu unserer Welt geworden.
Aber auch in kleineren Gruppen, die uns im Alltag umgeben, fügen wir uns ein. Wir identifizieren die inhärenten Hierarchien, die wir auffinden und tun alles, um auch hier einen angemessenen Platz einzunehmen. Auch wenn es heutzutage weder für Nahrung, Schutz, noch Partnerwahl entscheidend ist, gehen wir mit den kleineren Gruppen um uns herum um, als wären sie die gleichen, lebensentscheidenden, Stammes-ähnlichen Gruppierungen, in denen Menschen über viele Jahrtausende hinweg gelebt haben. Wir werden unglücklich, wenn wir einsam sind und strahlen vor Freude, wenn wir anerkannt oder bewundert werden. Dahinter steckt keine Magie oder mystische Kraft, sondern ein ganz schlichter Überlebenswille, der sich seit der Steinzeit wohl kaum gewandelt hat. Offensichtlich war das Überleben unserer Vorfahren akut gefährdet, wenn sie aus einer Stammesgemeinschaft ausgeschlossen wurden. Stell dir vor, man würde dich ächten, sodass du Zutritt zu keiner Gemeinde, keinem Markt, keinem anderen Menschen mehr hättest. Im Krankenhaus wirst du abgewiesen, aus dem Supermarkt herausgeschmissen. Wie überlebst du? Keine Kleidung, kein Besteck, kein Haus (baue ein Haus ohne Werkzeuge und Material), keine Nahrung, die du nicht selbst gefunden hast. Wir mögen hin und wieder von einem Aussteigerleben träumen, aber ohne jegliche Unterstützung auszukommen, wird uns beispielsweise im Winter Norden Europas nur wenige Stunden lang gelingen. So ist es nicht verwunderlich, dass unsere oberste Priorität geworden ist: Passe dich an die Menschen um dich herum an, werde wie sie; egal was passiert, du darfst nicht alleine bleiben. Werde wie sie, koste es, was es wolle. Auch wenn in vielen Ländern dieser Welt die Einsamkeit ihre akute Lebensbedrohlichkeit verloren hat, unser ursprüngliches Gefühl der Angst vor dem Verlust der Gruppenzugehörigkeit blieb erhalten.
Wie so oft, lassen sich solche Gefühle deutlicher bei Kindern beobachten, die ihre Emotionen noch unreguliert an der Oberfläche tragen. Denke zurück an die Zeit, in der du selbst ein Kind warst. Du gehst in die dritte Klasse und hast einen richtig schlechten Tag. Du triffst auf ältere Schüler, die dich nicht nur ärgern, sondern dich erniedrigen und dir Schmerzen zufügen. Auch deine Klassenlehrerin hat heute schlechte Laune und stellt dich vor der ganzen Klasse bloß, weil du deine Hausaufgaben vergessen hast. Als du nach der Schule nach Hause kommst, ist niemand da. Normalerweise ist um diese Zeit deine Mutter vor Ort und hilft dir bei den Hausaufgaben. Aber heute ist niemand da, die Fenster sind zu, alle Lichter aus. Du findest einen Zettel: „Wir sind weg und kommen nicht zurück“. Auch am nächsten Tag kommt niemand und du realisierst, dass der Zettel tatsächlich ernst gemeint war. Welcher Teil dieser Erzählung ist der angsteinflößendste, der deprimierendste? Das Schlimmste, was man Kindern antun kann, sind weder harte Worte noch Schläge. Alleine von den Eltern zurückgelassen zu werden, das ist die größte Angst, die kleine Kinder haben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auch Erwachsene ihr gesamtes Leben an den Gruppen ausrichten, zu denen sie denken gehören zu müssen. Allerdings ist hier die Notwendigkeit der Zugehörigkeit eher eine angsterfüllte Illusion. Was passiert, wenn der Nachbar uns nicht mehr „mag“? Warum müssen wir die Kollegin anlächeln und mit ihr über unseren letzten Urlaub sprechen? Wie schlimm ist es wirklich, wenn jemand eine andere politische Überzeugung oder Meinung hat? Könnten wir unser Steinzeithirn auf die aktuellen Gegebenheiten anpassen, müsste die Antwort auf all das sein: Es passiert nichts, was uns tatsächlich bedroht. Niemand muss mit uns sprechen und wir müssen uns mit der Kollegin nicht gut stellen, damit uns jemand hilft, wenn der nächste Ernteausfall eintritt oder uns ein Nachbarstamm überfällt. Es ist egal, welche Meinungen wir antreffen, sie bedrohen uns nicht persönlich. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass wir einer möglichst starken oder großen Gruppe angehören, um im nächsten Stammeskonflikt überleben zu können. Wir müssen es niemandem recht machen und keiner Gruppe Gehorsam schwören, um den nächsten Winter zu überstehen. Nach wie vor werden wir Nahrung, Schutz und Partner behalten – unserem Gutschein-basierten Wirtschaftssystem sei Dank.
Wir – die Autoren dieses Blogs – glauben, es wäre ratsam, die Regeln der kleinen und großen Gruppierungen um uns herum nicht zu ernst zu nehmen. Ja, unsere Kooperationsfähigkeit auf großen Skalen macht uns zu dem, was wir sind, und ermöglicht uns ein Leben in Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand. Ja, unsere Psyche ist nunmal wie sie ist und unsere sozialen Emotionen, die unser Verhalten in kleinen Gruppen steuern, bleiben, im Guten wie im Schlechten. Es gibt keinen Grund diese Dinge schlechtzureden oder loswerden zu wollen. Nicht zuletzt sind auch die schönsten und erfüllendsten Emotionen, die wir kennen, Teil des Pakets. Aber sie halten uns unter dem Deckmantel existentieller Ängste ebenso gefangen in schadhaften und vor allem willkürlichen Denkmustern und Lebensstrukturen. Die Denkmuster als solche zu erkennen und dementsprechend einzuordnen, macht sie flexibel und verhindert, dass wir starr auch dann an ihnen festhalten, wenn sie direkt in den Abgrund führen. Aber noch viel direkter können wir als Individuen einen Schritt zurücktreten und ihnen so ihren Schrecken nehmen. Und genau das ist es, was wir in diesem Blog schließlich zu erreichen suchen, mit Ruhe und Augenmaß.
Schaut man in andere Kulturen, lassen sich schadhafte Denkstrukturen leicht erkennen. Wie Hanno Sauer in „Moral“ beschreibt, gab und gibt es auf dieser Welt beispielsweise einige erstaunliche Initiationsriten für junge Männer und Frauen. Im Stamm der Etoro in Neuguinea ist es üblich, dass junge Männer den Samen von bereits hierarchisch entwickelten Männern oral aufnehmen müssen, um als Mann akzeptiert zu werden. Während wohl fast alle der 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt auf diese Praxis mit Verwunderung oder Ekel reagieren würden (dazu gehört auch der Nachbarstamm der Kaluli), ist anzunehmen, dass die Mitglieder der Etoro diesen Ritus als absolut normal empfinden. Der eben erwähnt Nachbarstamm der Kaluli erfordert übrigens die Aufnahme des Samens durch den Anus, was wiederum bei den Etoro für Unverständnis sorgt. Genauso sind auch Strafen für soziales Fehlverhalten gespickt mit absurd übertriebenen Details. Anstatt an einen anderen Ort zu schauen, lässt sich der gleiche Effekt des verwunderten Ekels auch durch durch eine zeitliche Verschiebung erreichen. Vielen ist bekannt, dass die in Europa universal verbreitete Todesstrafe bis ins 19. Jahrhundert hinein eine gigantische Palette an Grausamkeiten bot. Deutlich weniger bekannt ist allerdings, dass die Vollstreckungen der Todesurteile nicht nur als beliebte Spektakel, sondern ebenfalls als Quelle von Glück und Heilung betrachtet wurden. Es ist überliefert, dass Menschen sich um gerade hingerichtete drängten, um ihr frisches Blut, oder Teile ihres Körpers zu erhaschen. So beschreibt der Apotheker Johann Schröder noch Mitte des 17. Jahrhunderts die Herstellung von Medizin aus Leichenteilen hingerichteter Personen während Zeitgenossen Finger oder Penisse in ihre Bierfässer hingen, um sie besser verkaufen zu können. Der Handel mit solchen „Glücksbringern“ war weit verbreitet und allgemein als normal anerkannt. Nicht zuletzt die abgetrennten Gliedmaßen von Neugeborenen waren europaweit begehrte Accessoires, die den Träger sogar unsichtbar machen könnten, wie es beispielsweise aus dem Tagebuch des Nürnberger Scharfrichters Meister Frantz aus dem 16. Jahrhundert überliefert ist.
Diese grausamen und abstoßenden Beschreibungen sozial etablierter Verhaltensweisen könnten über einige Bücher hinweg diskutiert werden. Unsere kurzen Ausführungen oben sollen nur zeigen: All das ist absolut nicht verwunderlich, sondern genau das, was in einer kompromisslos-sozialen Gesellschaftsstruktur zu erwarten ist. Kein Ritus, keine Regel ist absurd, wenn sie gemeinschaftlich gelebt wird.
Egal also, wer diesen Text nun liest: Du unterscheidest dich in Körper und Gehirn nicht von den Stammesmitgliedern des Stammes Etoro, die junge Männer zum Oralsex mit ihren Stammesältesten drängen oder den Europäern, die mit Bechern vor einem frisch enthaupteten Torso standen, um das daraus sprudelnde Blut zu trinken. Richte also deinen Blick auf die Gegenwart und die kleinen und großen Gruppen um dich herum und frage dich mit gleicher Strenge, welchen Regeln du folgst oder was du von anderen Menschen erwartest. Und noch viel wichtiger: Wenn du sozialen Druck verspürst, dich anzupassen und dich den Interessen einer Gruppe unterzuordnen, führe dir vor Augen, dass die Angst, die in dir hochsteigt, einer Illusion entspringt. Nutze an dieser Stelle die Vorteile unsere moderne Welt, um dir und anderen etwas Gutes zu tun – trete einen Schritt zurück, erkenne das Gesellschaftsspiel, das um dich herum gespielt wird und treffe entspannt die nächste Entscheidung. Du bist freier und sicherer als du glaubst.
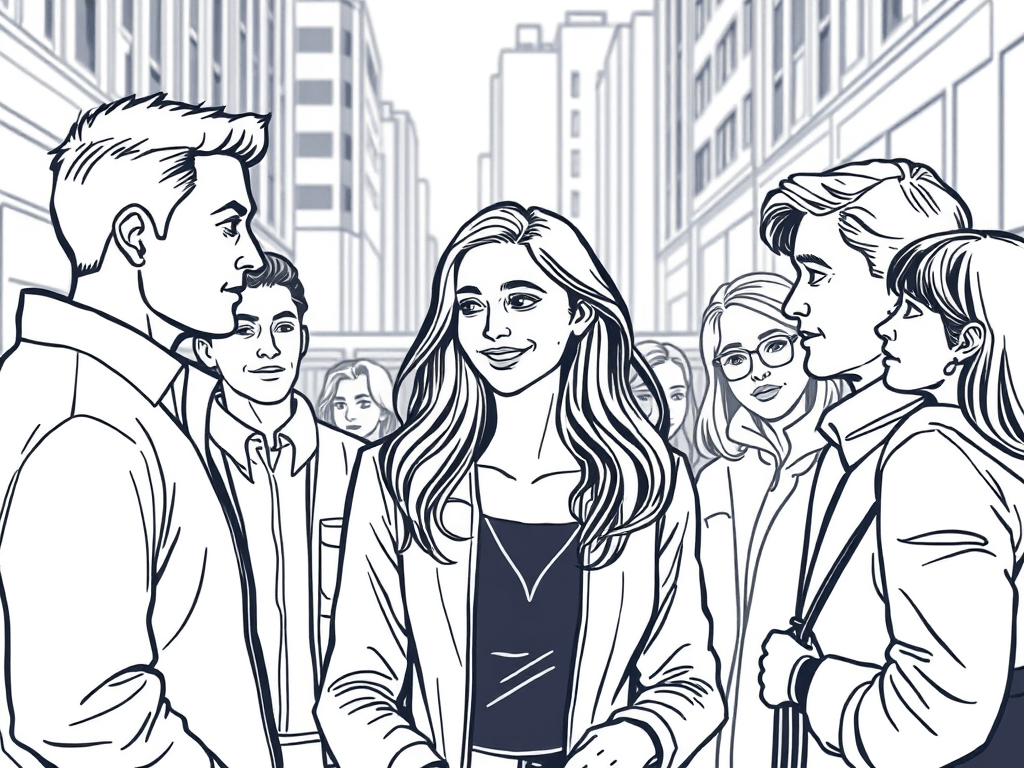
Leave a comment